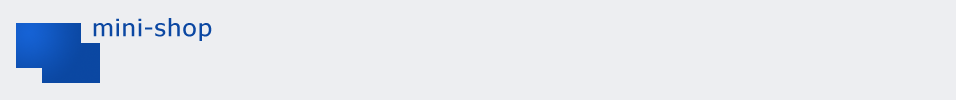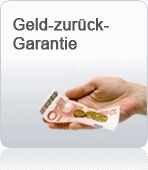Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Die Kraft des Handelns - Wie wir Bewegungen für das 21. Jahrhundert bilden
von: Alicia Garza
Tropen, 2020
ISBN: 9783608116472 , 400 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 15,99 EUR
eBook anfordern 
Kapitel 1
Wo ich herkomme
Frantz Fanon hat gesagt: »Jede Generation muss, in relativer Undurchsichtigkeit, ihre Mission erkennen und erfüllen oder sie verraten.« Das ist die Geschichte jeder politischen Bewegung: Jede Generation hat eine Mission, die ihr von der vorherigen übertragen wurde. Es liegt an uns zu entscheiden, ob wir diese Mission annehmen wollen und an ihrer Erfüllung arbeiten oder uns von ihr abwenden und scheitern.
Unsere gegenwärtige Realität lässt sich kaum treffender beschreiben. Konfliktbeladene Generationen haben hierzulande und auf der ganzen Welt unsere Lebenswelt geformt. Es ist an uns zu entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, wie unsere Umwelt und damit auch wir geprägt wurden. Wie können wir herausfinden, was unsere Mission ist, unsere Rolle, und wie die Erfüllung dieser Mission aussieht, sich anfühlt? Woher nehmen wir den Mut, uns der Aufgabe zu stellen, die uns von denen anvertraut wurde, die über die Unzulänglichkeit des Status quo entschieden haben? Wie können wir unseren ganzen Kampfgeist zusammennehmen, um jetzt und in Zukunft einen Sieg davonzutragen?
Bevor wir wissen können, welche Richtung wir einschlagen – die erste Frage, die sich jeder Formation stellt, die sich Bewegung nennt –, müssen wir herausfinden, wo wir stehen, woher wir kommen und was uns im Hier und Jetzt von zentraler Bedeutung ist. Damit beginnt jede Bewegung.
Wir sind alle durch die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit geprägt. Meine Eltern zum Beispiel: Meine Mutter und mein Vater wurden beide in der Mitte der 1950er Jahre geboren und wuchsen in den 1960er und 1970er Jahren heran. Mein Vater in San Francisco, Kalifornien, in einer wohlhabenden jüdischen Familie, die über Generationen durch Erbschaften und den Besitz und Betrieb eines erfolgreichen Geschäfts zu Reichtum gekommen war. Meine Mutter hingegen kam in Toledo, Ohio, als Tochter eines Fernfahrers und einer Hausangestellten zur Welt und wuchs in konträren Verhältnissen auf. Verglichen mit der Familie meines Vaters gehörten sie zur Arbeiterschicht, galten aber im Verhältnis zu anderen Schwarzen Familien als solider Mittelstand. Toledo war Firmensitz der Libbey Glass Company und anderer Unternehmen, die einen Großteil der Bevölkerung beschäftigten. Das Wohnviertel meiner Großeltern setzte sich aus polnischen Immigrant*innen und Schwarzen Familien aus der Mittelschicht zusammen, bis die Familien mit polnischen Wurzeln allmählich in die Vororte abwanderten.
Meine Mutter wollte mehr Freiheiten haben, als in ihrer Familie und ihrer Community vorgesehen war, also machte sie sich auf den Weg: Als junge Frau zog sie zuerst nach New York und trat dann in die Armee ein, in der sie für ihre Grundausbildung in Fort McClellan in Alabama stationiert wurde, dann für weitere Ausbildung nach Fort Dix in New Jersey verlegt wurde, bevor man sie schließlich in Richtung Westen, nach Fort Ord, schickte.
Sie wuchs in einem Umfeld auf, in dem Schwarze Frauen eine Anstellung als Sekretärin, Hausangestellte oder Verkäuferin im Einzelhandel anstreben konnten. Mein Vater wurde hingegen in einer Umgebung groß, in der seine Familienangehörige wegen ihrer jüdischen Abstammung und Identität zwar eine gewisse Diskriminierung erfuhren, aber meistens als begüterte Weiße durchgingen und ihnen folglich alle Möglichkeiten offenstanden.
Ich wiederum wuchs in einem ganz anderen Umfeld heran, in einer Zeit und an einem Ort, die für mich einzigartig waren. Ich habe mein Weltverständnis aus anderen Perspektiven entwickelt als meine Eltern oder die meisten meiner Gleichaltrigen. Und doch sind wir alle hier, sind in diesem Augenblick am Leben und ergeben zusammen eine Welt voller Sichtweisen und Erfahrungen, die manchmal harmonisieren, manchmal aufeinanderprallen und füreinander manchmal nicht zu erkennen sind. Wir alle sind zu unterschiedlichen Zeiten zu diesem weltverändernden Projekt dazugestoßen – meine Eltern rückten in einem Chevy Camaro von 1966 an, ich kam in einem Hybrid, und die Generationen der 1990er und 2000er Jahre erschienen auf Elektro-Tretrollern, betrieben von der Citibank. Aber nun sind wir alle da.
Unsere ganz unterschiedlichen Perspektiven betreffen nicht nur ästhetische, philosophische oder technologische Fragen. Sie beeinflussen auch unser Verständnis, wie Wandel auf den Weg zu bringen und für wen er notwendig ist, welche Methoden akzeptabel sind, um ihn zu bewältigen, und welche Art Wandel überhaupt möglich ist. Die Zeit, der Ort und die Verhältnisse, unter denen ich aufgewachsen bin, haben stark mitbestimmt, wie ich die Welt sehe und wie ich inzwischen über Veränderung denke. Also lasst mich euch erzählen, wer ich bin, und um das zu tun, muss ich notwendigerweise von meiner Mutter erzählen, die mir die eindrücklichste Lektion in Sachen Politik erteilt hat: Der erste Schritt heißt verstehen, was wirklich zählt.
Meine Mutter war 25 Jahre alt, als sie mit mir schwanger wurde. Mein biologischer Vater, sagte sie trocken, sei nicht gerade begeistert gewesen, habe sich aber gegen einen Abbruch ausgesprochen. Ich fragte sie, ob sie mich denn habe behalten wollen. »Hast du Angst gehabt, Mami? Warst du beim Gedanken an ein Baby irgendwie verunsichert?« Ich versuchte, eine ehrliche Antwort zu bekommen, ihr ein so entspanntes Gefühl zu geben, dass sie mir ruhig die Wahrheit sagen konnte. »Nein, ich wusste, dass ich dich bekommen wollte«, sagte sie mir. »Es war nicht geplant, aber als es passiert ist, war ich bereit, mich der Verantwortung zu stellen und mich auf sie einzulassen.« Typisch Mami. Mit ihren gut 1,60 Metern entschlossen und stark wie ein Ochse.
Sie hatte meinen leiblichen Vater eine Zeitlang wirklich geliebt, doch schließlich ging die Beziehung in die Brüche. Ab da blieb ihr nicht viel anderes übrig, als sich zu überlegen, wie sie sich und ihr Kind durchs Leben bringen konnte. Für sie lag das alles lang zurück. Und sie gab sich alle Mühe, die Vergangenheit zu verdrängen und über sie hinwegzukommen.
Meine Mutter identifiziert sich nicht als Feministin. Tatsächlich erinnere ich mich nicht, dass sie das Wort je ausgesprochen hätte. Sie misstraute Männern ebenso wie Frauen: Ihrer Erfahrung nach haben Männer sie unterschätzt und sie auszunutzen versucht, während ihr manche Frauen in den Rücken fielen oder sie als Konkurrentin betrachteten – meistens um die Aufmerksamkeit von Männern. In meiner Kindheit bekam ich ständig Geschichten zu hören, wie ich mich vor übergriffigen Männern und Frauen schützen sollte. »Du musst wissen, wann es Zeit ist, nach Hause zu gehen«, sagte sie und ermahnte mich, einen kühlen Kopf zu bewahren und vorherzusehen, wann eine Situation gefährlich zu werden droht. »Schau immer, wo die Ausgänge sind«, sagte sie für den Fall, dass ich mich aus einer Notlage befreien müsste. »Behalte deine Segnungen für dich«, sagte sie, als lauere jemand hinter der Ecke, um sie mir zu entreißen.
Für sie und für mich lautete die entscheidende Frage nicht, ob sie Feministin, sondern ob sie fähig war, für uns beide zu sorgen. Sie wuchs in einer Zeit auf, als die Rolle einer Frau sich darin erschöpfte, Kinder großzuziehen, den Haushalt zusammenzuhalten und den Männern den Rücken freizuhalten. Dagegen lehnte sich meine Mutter Zeit ihres Lebens aktiv und bedingungslos auf. Mit 18 Jahren zog sie nach New York, um als Sekretärin für einen Kameramann zu arbeiten, und lebte zwei Jahre allein. Als sie den Militärdienst antrat, war sie die einzige Frau in einer rein männlichen Kolonne und dachte gar nicht daran, die Frauen zugedachten Rollen zu übernehmen. In ihrer Anstellung in einem Gefängnis in Kalifornien musste sie sich gegen die sexuellen Avancen ihres verheirateten Chefs zur Wehr setzen. Und als der Mann, den sie heiraten wollte, sich mit anderen Frauen traf, während sie mit mir schwanger war, musste sie lernen, für sich selbst und für ihre Tochter zu sorgen. Ihr Feminismus – ihre politische Einstellung – war ihr Kampf, mit allen gebotenen Mitteln durchs Leben zu kommen.
In einer meiner frühesten Erinnerungen sprach ich meine Mutter auf ein Poster an, das sie in dem Apartment aufgehängt hatte, das wir uns mit meinem Onkel teilten. Es zeigte eine schöne Schwarze Frau, die meiner Mutter ähnelte – so sehr, dass ich sie immer wieder fragte, ob sie ganz bestimmt nicht die Frau auf dem Poster sei. Lässig in ihr goldenes Kopftuch gehüllt, blickte die Frau neben den Worten in die Ferne: »For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf«.
Ich wusste überhaupt nichts von diesem berühmten Choreopoem, hatte aber damals – und habe heute noch – das Gefühl, dass in einer Gesellschaft, die Schwarze in so...