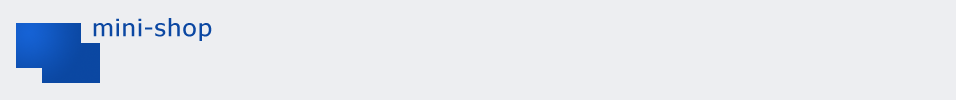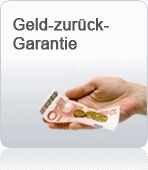Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Der Braune Bär fliegt erst nach Mitternacht - Unsere Naturschätze. Wie wir sie wiederentdecken und retten können
von: Johanna Romberg
Quadriga, 2021
ISBN: 9783751704151 , 288 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 17,99 EUR
eBook anfordern 
Mehr zum Inhalt

Der Braune Bär fliegt erst nach Mitternacht - Unsere Naturschätze. Wie wir sie wiederentdecken und retten können
SONNENAUFGANG IM VORFRÜHLINGSWALD
EINLEITUNG
Einladung
zum Hinschauen
Einige Momente lang dachte ich, sie wären tatsächlich verschwunden, für immer.
Es war ein Frühjahrsmorgen, etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Ich stand im Wald, Klemmbrett, Notizzettel und Stift in der Hand, bereit, die ersten Vogelstimmen des Tages zu notieren. Wie schon in den vergangenen Jahren hatte ich einen milden, trockenen Tag Mitte März genutzt, um den nahe gelegenen Mischwald zu besuchen, in dem ich regelmäßig Vögel zähle. Die Daten, die ich ermittle, leite ich an das »Monitoring häufiger Brutvögel« weiter, ein seit 1989 laufendes Programm, an dem sich Tausende vogelkundiger Menschen in ganz Deutschland beteiligen.
Normalerweise umgibt mich im Wald eine Klangwolke aus Dutzenden Stimmen, sobald ich aus dem Auto steige. An diesem Morgen aber herrschte unheimliche Stille. Unheimlich auch deshalb, weil es bereits hell wurde; normalerweise setzt der morgendliche Chor schon ein, wenn es noch stockdunkel ist.
Ich beobachte Natur lange genug, um zu wissen, dass die Vogelpopulation eines halbwegs intakten Lebensraums normalerweise nicht einfach spurlos verschwindet – zumal dann nicht, wenn sie, laut meinen eigenen gewissenhaften Zählungen, einige Hundert Individuen umfasst. Dennoch kroch, während ich in den schweigenden Wald hineinhorchte, Angst in mir hoch. Ich hatte in den Monaten und Jahren zuvor so viele Berichte über das fortschreitende Artensterben gelesen, so viele Warnungen vor einem bevorstehenden »stummen Frühling«, dass mir diese Stille wie ein wahr gewordener Alptraum vorkam, als wäre die Vision einer vogelfreien Zukunft auf einen Schlag Gegenwart geworden.
Es war zum Glück nur ein kurzer Schrecken. Nach einigen Minuten, die mir endlos vorkamen, ertönte aus einem Dickicht hinter mir die leicht vibrierende, glasklare Stimme eines Rotkehlchens. Das war wie ein Signal für die übrigen Vögel, die schon singbereit in den umliegenden Bäumen und Büschen hockten. Zwei weitere Rotkehlchen antworteten ihrem Vorsänger, dann setzte, noch etwas zögerlich, die erste Singdrossel ein, der erste Zaunkönig, und nach kaum mehr als einer Minute war der Wald so erfüllt von Gesang, dass ich Mühe hatte, noch einzelne Stimmen herauszuhören. Ich ließ Klemmbrett und Stift sinken und gab mich ein paar Minuten lang einfach der Klangwolke hin. Sie war so laut, so dicht gewebt, so bezaubernd, dass ich darüber alles andere vergaß – auch meine Angst vor einer vogelfreien Zukunft.
Dieses Frühjahrserlebnis liegt mittlerweile Monate zurück, aber ich erinnere mich oft daran – auch, weil es so typisch ist für die Art, wie ich Natur mittlerweile wahrnehme. Schon seit Jahren fühle ich mich in einem ständigen Zwiespalt: Einerseits kenne ich kaum etwas Schöneres, als durch eine halbwegs lebendige Landschaft zu laufen, den Vögeln zu lauschen, mich in das Muster eines Schmetterlingsflügels zu vertiefen, das Blütensortiment auf einem Wegrandstreifen zu inspizieren und darüber für ein paar Momente den Rest der Welt und mich selbst zu vergessen.
Andererseits lebe ich in ständiger Sorge, dass das, was mir seit meiner Kindheit lieb und teuer ist, früher oder später verschwunden sein könnte, ein Opfer des Ausbeutungsfeldzug, den wir Menschen – vor allem die Wohlhabenden unter uns, die überdurchschnittlich viele Ressourcen beanspruchen – gegen die Natur führen.
»Natur« ist ein weiter Begriff, der letztlich alles einschließt, was nicht von Menschen gemacht ist. Ich verwende ihn hier vor allem als Synonym für »Biodiversität«. Das sperrige Wort steht für den Reichtum des Lebens auf der Erde, der vom Kleinsten wie Pflanzengenen oder Mikroben über die Vielfalt der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bis hin zu ganzen Lebensräumen reicht – Landschaften und Ökosystemen, die so unterschiedlich sind wie die arktische Tundra, die Korallenriffe der Tropenregion oder auch ein Laubmischwald in der Norddeutschen Tiefebene.
In diesem Buch wird es allerdings nicht um die Naturschätze der Tropen oder der Arktis gehen, auch nicht um die Erforschung des Mikrokosmos der Gene. Sondern um den Teil der Natur, der sich ohne Hightech-Hilfsmittel und Langstreckenflüge erleben lässt: die Vielfalt vor unserer Haustür. Diese Beschränkung hat ihren Grund. Ich wollte kein Grundsatzwerk über den Zustand der globalen Biodiversität verfassen – das haben andere vor mir umfassender und kompetenter getan, als ich es je könnte. Viel lieber schreibe ich über das, was ich aus eigener Anschauung kenne oder ohne großen Aufwand erkunden kann, und ich versuche, es so zu zeigen, dass auch andere Lust bekommen, es anzuschauen.
Ich habe nämlich eine These, die auf Anhieb vielleicht schlicht klingt, von der ich aber zutiefst überzeugt bin: Wenn wir wollen, dass unsere Naturschätze überleben oder gar wiederaufleben, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie angeschaut werden, von möglichst vielen Menschen. »Angeschaut« nicht im Sinne von kurz hingeguckt und nebenbei zur Kenntnis genommen, sondern von bewusst und intensiv erfahren – neugierig, wissbegierig, forschend, natürlich auch besorgt und Verluste abschätzend, aber auch lustvoll, hingerissen, selbstvergessen und verliebt. Ich bin überzeugt, dass tiefe emotionale Verbundenheit das stärkste Motiv ist, sich für die Bewahrung der Natur zu engagieren. Und wenn ich Sie beim Lesen dazu anregen kann, diese Verbindung neu zu suchen oder zu stärken, dann ist ein wichtiges Anliegen dieses Buches schon erfüllt.
Dass ich mich auf die Betrachtung der heimischen Artenvielfalt und ihrer Überlebenschancen konzentriere, heißt nicht, dass ich den Rest der Welt ausblende. Im Gegenteil: Gerade als Vogelbeobachterin ist mir nur zu bewusst, wie sehr unsere heimischen Ökosysteme mit denen weit entfernter Gebiete verknüpft sind und wie sehr fast alles, was ich in meiner näheren und weiteren Umgebung beobachte, von globalen Entwicklungen beeinflusst wird. Ich kann keine hundert Schritte durch die Landschaft gehen, ohne dass mir entsprechende Fragen durch den Kopf gehen.
Die Schwalben, die sich dort auf dem Koppelzaun versammelt haben: Werden sie den Zug in den Süden überstehen, ohne abgeschossen zu werden, in einem Vogelfangnetz zu landen oder in ihrem afrikanischen Winterquartier an Hunger oder Hitzestress zu verenden? Der Admiral, der dort einsam zwischen den Distelblüten flattert: Waren vor zwei, drei Jahren nicht noch Dutzende Falter an derselben Stelle unterwegs, und nicht nur Admirale, sondern noch andere Arten? Die Eichen an der Straße zu meinem Zählgebiet, die schon im vergangenen Jahr erste braune Zweige aufwiesen: Werden sie die kommenden Dürresommer überleben?
Zugvogeljagd. Lebensraumzerstörung. Insektensterben. Klimakrise. Wer regelmäßig die Nachrichten zum Zustand der Biosphäre verfolgt, braucht starke Nerven, denn gerade in den letzten Jahren kommen sie immer mehr einem Trommelfeuer an Hiobsbotschaften gleich. Der Reichtum an Leben, der in Milliarden Jahren gewachsen ist – er wird gerade weltweit in atemberaubendem Tempo vernichtet. Längst sprechen Biologen und Ökologen vom »sechsten Massenaussterben«, das bereits jetzt ähnliche Dimensionen angenommen hat wie die fünf, die sich in vergangenen Epochen der Erdgeschichte ereignet haben. Das bislang letzte wurde vor etwa 65 Millionen Jahren von einem Kometeneinschlag ausgelöst; der darauffolgende globale Temperatursturz führte zum Aussterben nicht nur der Dinosaurier, sondern von 76 Prozent aller damals existierenden Tier- und Pflanzenarten.
Der Vergleich der Gegenwart mit dieser lange zurückliegenden Apokalypse scheint nicht übertrieben: Nach Berechnungen der Weltnaturschutzorganisation IUCN gehen zurzeit jeden Tag hundert Arten für immer verloren – das entspricht dem Tausend- bis Zehntausendfachen dessen, was die Evolution im gleichen Zeitraum auf natürlichem Wege »aussortieren« würde. Und es sind nicht allein die Arten, die verschwinden oder an den Rand des Aussterbens geraten – es ist die schiere Masse an Lebewesen, die vernichtet wird.
Seit 1972, also in wenig mehr als der Hälfte eines Menschenlebens, sind 68 Prozent aller Wirbeltiere vom Erdboden verschwunden – Säugetiere, Vögel, Fische und Amphibien. Und allein seit der Jahrtausendwende sind weltweit knapp zwei Millionen Quadratkilometer noch intakter Wildnis zerstört worden – ein Gebiet, das der Größe von Mexiko entspricht. Damit sind nicht nur Lebensräume für unzählige Pflanzen und Tiere verloren gegangen, sondern auch Grundlagen für menschliches Leben: Wälder, die Wasser speichern und Hitzewellen mildern, Moore, die vor Hochwassern schützen und Kohlenstoff um ein Vielfaches effektiver speichern als Wälder, Insektenschwärme, die unschätzbare Bestäubungsdienste leisten, Mangroven und Seegraswiesen, ohne die wesentliche Teile der Welternährung zusammenbrechen würden, weil sie als Kinderstube für Fische unersetzlich sind.
Vor einiger Zeit hat der Weltbiodiversitätsrat IPBES die wichtigsten Treiber der globalen Zerstörung ausgemacht – zu ihnen zählt, nicht überraschend, der menschengemachte Klimawandel. Am gravierendsten jedoch wirken sich direkte Eingriffe in die Natur aus: etwa die Rodung von Wäldern zur Gewinnung von Acker- und Weideland, unregulierte Jagd und die Plünderung der Meere durch industrielle Fischerei.
Manchmal wünschte ich mir, ich könnte die Hiobsbotschaften zum Thema Natur einfach ausblenden und zur Tagesordnung übergehen – so, wie es viele andere ja auch tun, nicht zuletzt die vielen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die diesen Zerstörungen tatenlos zusehen oder sie gar aktiv vorantreiben. Aber das Nicht-Hinsehen...