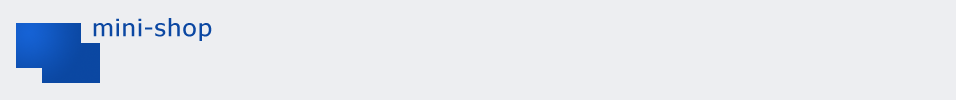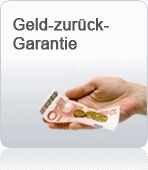Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Wiedersehen in der Wüste - Wie mein Mann meine Kinder entführte und ich mein Leben riskierte, um sie zu retten
von: Amin, Helle
Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, 2021
ISBN: 9783732598564 , 321 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 9,99 EUR
eBook anfordern 
Mehr zum Inhalt

Wiedersehen in der Wüste - Wie mein Mann meine Kinder entführte und ich mein Leben riskierte, um sie zu retten
1
Gestohlen
Der 23. Januar 2002 begann wie jeder andere Tag auf meiner tropischen Insel. Warmer Sonnenschein, steigende Temperaturen – es war Zeit, aufzustehen. Ich weckte die Kinder und ging die Treppe hinunter, um mit den beiden Hausangestellten den Tag zu besprechen. Eine von ihnen hatte bereits Frühstück für uns gemacht.
»Alles fertig!«, rief ich und hoffte, die anderen würden mir zuhören. »Frühstück steht auf dem Tisch!«, fügte ich ein paar Minuten später etwas lauter hinzu. Vielleicht würde ich so mehr Erfolg haben.
Eilig kamen die Jungs aus ihren Zimmern und schnappten sich Brot und Marmelade vom Tisch, um sich damit ins Fernsehzimmer zu verziehen.
»Sitzen bleiben!«, befahl ich und bekam sofort enttäuschte Gesichter zu sehen. »Kein Fernsehen, heute ist Schule.«
»Aber Mum! Bitte!«, flehte der fünfjährige Adam.
»Nichts da. Setz dich ordentlich an den Tisch.«
Max und Alex, die Zwillinge, hatten ebenfalls Einwände. Die Liste ihrer Lieblingssendungen im Satellitenfernsehen war lang – typisch für Zehnjährige. Zak war zwar noch zwei Jahre jünger, aber er holte schnell auf.
Jeder Gedanke an Fernsehen verschwand sofort, als T zum Frühstück kam. Seine Stimmung schien noch schwärzer zu sein als gewöhnlich. Schweigen legte sich über den Esstisch. Wenigstens essen die Kinder jetzt, dachte ich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es unser letztes gemeinsames Frühstück für die nächsten sechzehn Monate sein würde.
»Ich bring sie zur Schule«, sagte T. Wie üblich übermittelte er nur die Grundfakten. »Wir fahren jetzt, bis später.«
Die Kinder nahmen ihre Taschen, gaben mir einen Abschiedskuss und folgten T zur Tür hinaus. Der Motor startete, die Tür ging zu, und meine Kinder waren weg.
Ich blieb noch einen Moment sitzen. Irgendwie müsste es doch möglich sein, die Atmosphäre im Haus zu verbessern und die Anspannung in meiner Ehe zu verringern.
Wir hätten England nie verlassen dürfen, sagte ich mir, während die Hausangestellten um mich herum damit beschäftigt waren, den Tisch abzuräumen. Warum in aller Welt hatten wir uns dazu entschlossen, nach Bali zu ziehen?
Ich dachte über die jüngere Vergangenheit nach, betrachtete die größeren Probleme und analysierte sie. Der Umzug nach Bali hatte seinerzeit nach einer guten Idee ausgesehen. T hatte ein Möbelgeschäft dort aufgemacht, und obwohl er damit grandios gescheitert war, blieben wir und verwandelten das Gebäude in die English School Bali.
Am Anfang war das ein spannendes Projekt. Ich hatte das Gefühl, es könnte funktionieren, zumal ich als ausgebildete Lehrerin Erfahrung in diesem Bereich hatte. Doch bald stellte sich heraus, dass T und ich nicht zusammen arbeiten konnten. Nachdem ich sehr viel Mühe in die Schule gesteckt hatte, war ich wieder einmal die brave Hausfrau.
Die Mädchen verließen das Zimmer, ich blieb sitzen und dachte weiter nach. Warum muss ich ihm ständig gehorchen?, fragte ich mich, wohl wissend, dass sich daran nichts ändern würde. T beherrschte unser Haus mit seiner üblen Stimmung. Ich verabscheute die Szenen, die er veranstaltete. Ich hasste sie wirklich abgrundtief.
Im Rückblick denke ich, man hätte den großen Knall vorausahnen können, schon einige Zeit bevor die Kinder verschwanden. Wir stritten und diskutierten ständig. Aber das taten doch alle Paare, oder? Mit Gedanken wie diesem versuchte ich mich zu beruhigen. Doch allmählich musste ich der Realität ins Gesicht sehen: Die Sache geriet außer Kontrolle.
»Ich hasse dieses Leben. Ich hasse mein Leben«, sagte ich mir immer wieder.
Die Hausangestellten sahen, dass es mir schlecht ging, aber sie verstanden nicht, was ich da vor mich hin redete.
Ich trank den Rest meines kalten Kaffees und ging in mein Schlafzimmer – schon länger teilte ich mit T nicht mehr das Bett –, um weiter nachzudenken. Vielleicht war ich ja wirklich zu aufsässig, überlegte ich. Vielleicht passten wir ja charakterlich nicht zusammen. Natürlich hätte ich ein Wort mitreden müssen, was die Schule anging, schließlich hatte ich sie ja auch mit gegründet. Warum wollte er keinen Input von mir?
Auf dem Rücken liegend bohrte ich tiefer, was unsere katastrophale Beziehung anging, und stellte eine ganze Liste mit Problemen zusammen. So musste ich zum Beispiel um Geld bitten, wenn ich für unseren Haushalt einkaufen ging. Teurer Luxus kam ohnehin nicht infrage. T hielt alles unter Kontrolle. Die Pässe der Kinder hatte er irgendwo versteckt. Ich saß in der Falle.
Vielleicht konnte ich noch ein bisschen schlafen. Mehr blieb mir gar nicht zu tun, die Angestellten kümmerten sich ja um alle Arbeiten. So eine Ferieninsel ist wunderbar, wenn man Ferien macht, aber wenn man dort lebt, verliert sich die Attraktivität sehr schnell.
Doch ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich musste mit jemandem reden, aber meine engsten Freunde und meine Familie befanden sich ja am anderen Ende der Welt.
Der Tag lief dahin wie so viele zuvor, vom Morgen zum Mittag, zum Nachmittag. Ich ließ mich treiben wie ein Stück Holz auf dem Wasser, ohne Ziel und Richtung.
T und die Kinder kamen gegen drei aus der Schule – und damit begann der bei Weitem schlimmste Tag in meinem Leben erst richtig. T trank schnell eine Tasse Tee. Wir sprachen kein Wort miteinander, sahen uns kaum an, dann ging er wieder. Vielleicht war es ja so, dass ich in seiner Welt gar nicht mehr existierte.
Die Kinder spielten wie sonst auch, machten dann noch ein paar Hausaufgaben. Der erste Hinweis auf den Albtraum, der uns bevorstand, kam in Gestalt eines Anrufs am Nachmittag. Eine der britischen Lehrerinnen meldete sich. »Du kommst nie darauf, wen ich gerade bei der Einwanderungsbehörde gesehen habe«, sagte sie mit nervöser Stimme, langsam und sehr betont. »T war dort, er hat offenbar Pässe abgeholt, und ich meine, es waren auch Ausreisevisa für ihn und deine Kinder dabei. Ich konnte es nicht so genau erkennen, aber es sah wirklich so aus. Ich dachte, ich sage dir lieber Bescheid.«
Sie wusste von unseren Eheproblemen und fragte sich natürlich, was da vorging. Offenbar hatte sie sogar das Gespräch zwischen T und einem der Beamten belauscht. Ich wusste, dass Geschäftsleute ein Ausreisevisum brauchen, wenn sie Bali verlassen wollen. Für Touristen gelten andere Bestimmungen.
Ich bat sie, mir noch einmal genau zu schildern, was sie gesehen und gehört hatte. Und während ich ihr zuhörte, lief mir ein Schauer über den Rücken, mein Magen drehte sich um. Mir wurde regelrecht übel. Gleichzeitig spürte ich Anspannung und großen Zorn, es war wie ein psychischer und physischer Schmerz. Doch ich kämpfte die Emotionen nieder und blieb ruhig.
Als T zum Abendessen zurückkehrte, bat ich ihn, sich hinzusetzen, damit wir reden konnten. Er weigerte sich, meinte, er sei beschäftigt. Doch ich blieb hartnäckig und lief ihm nach durchs ganze Haus.
»Warum hast du die Pässe zur Einwanderungsbehörde gebracht? Was soll das mit den Ausreisevisa? Wohin willst du? Was geht hier vor, zum Teufel?«
Für mich gab es kein Ausreisevisum, das wusste ich, denn mein Pass steckte immer noch in meiner Handtasche.
Als ich T berichtete, was meine Freundin gesagt hatte, reagierte er sehr aggressiv. Er erklärte mir, es sei vollkommen normal, Ausreisevisa zu beantragen, denn es könne ja jederzeit sein, dass er und die Kinder die Insel verlassen müssten. Reine Routine. Er war ganz offensichtlich wütend, dass man ihn beobachtet hatte.
Man konnte ihm ansehen, dass diese Wendung der Ereignisse ihn überraschte. Er wirkte wie vor den Kopf geschlagen. Sein Gesicht lief rot an, er konnte gar nicht richtig antworten. Ich hatte ihn auf frischer Tat ertappt. Aber er würde mir auf keinen Fall sagen, was er plante.
Zunächst einmal gab er Fersengeld. Bevor ich ihm noch mehr Fragen stellen konnte, lief er weg und verließ das Haus. Im Hinausgehen sagte er noch etwas von einer wichtigen Besprechung. In meinem Kopf dröhnten nur noch die Wörter »Pässe« und »Visa« herum. Er konnte doch wohl keine Urlaubsreise ohne mich planen? Oder hatte er noch Schlimmeres vor?
Ich lief ihm nach und rief: »Ich will eine Antwort! Jetzt! Komm zurück und gib mir eine Antwort!« Ich war selbst überrascht, wie überzeugend ich klang. Für ein paar Sekunden gefiel mir diese Haltung.
Ich versuchte, mich ihm in den Weg zu stellen, aber er schob mich zur Seite und schloss das Gartentor fest hinter sich. Bevor ich zu ihm aufschließen konnte, saß er schon im Auto und fuhr los. Ich erinnere mich, dass ich mitten auf der Straße in Tränen ausbrach, weil hier irgendetwas ablief, bei dem ich nicht erwünscht war.
Während T zu seiner »Besprechung« außer Haus war, brachte ich die Kinder ins Bett, gab ihnen ihren Gutenachtkuss und deckte sie zu – die letzte körperliche Zuwendung, die sie in den nächsten anderthalb Jahren von mir bekommen sollten. Der letzte Junge, der seinen Gutenachtkuss bekam, war Zak, ein zärtliches Küsschen auf die Stirn, bevor ich sein Zimmer verließ.
Dann machte ich weiter wie gewöhnlich und half den Angestellten, das Haus in Ordnung zu bringen. Anschließend beschloss ich, noch ein paar Vorräte im Laden einzukaufen, Dinge, die ich den Jungs am nächsten Tag in ihre Brotdosen tun wollte.
Ich war höchstens vierzig Minuten weg, doch während meines Einkaufs überlegte ich, ob es eine gute Idee gewesen war, das Haus zu verlassen. Am besten wäre es, meine Söhne ununterbrochen zu bewachen, aber das ließ sich ja gar nicht bewerkstelligen. Vernünftiger wäre es gewesen, sie vorsorglich zu einer Freundin zu bringen, aber auf die Idee kam ich nicht.
Auf der Heimfahrt hatte ich das ungute Gefühl, es könnte etwas...