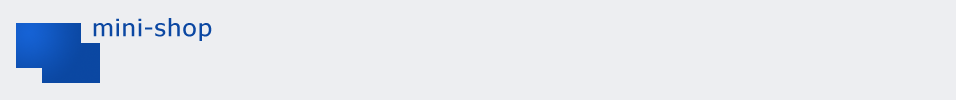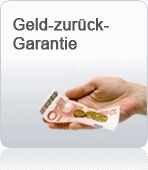Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Halten die Systeme im Ernstfall?
von: Corinne Michaela Flick
Wallstein Verlag, 2024
ISBN: 9783835386372 , 288 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 11,99 EUR
eBook anfordern 
Jörn Leonhard
Der Ernstfall als Krise der Steuerung und Legitimation: Eine historische Betrachtung
»Katastrophen« kenne »allein der Mensch, sofern er sie überlebt; die Natur kennt keine Katastrophen.« Max Frischs Diktum, formuliert in seiner 1979 zuerst erschienenen Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän, verweist auf die Ebene der Wahrnehmung und Deutung eines Krisenereignisses. Der »Ernstfall« stellt insofern nicht von vornherein eine objektive Gegebenheit dar, er setzt vielmehr ein Krisenbewusstsein der Menschen und die daraus hervorgehende Deutung und Einordnung von Erfahrungen voraus. Betrachtet man Revolutionen und Kriege als paradigmatische Beispiele von »Ernstfällen«, so wirkten sie in der neuzeitlichen Geschichte immer wieder als Effizienztests für politische und soziale Ordnungen. Das Ergebnis konnte sich in Legitimationskrisen äußern, die bis zur Erosion einer Ordnung reichen konnten, oder aber in beschleunigten Anpassungsleistungen von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.
I. Der historische »Ernstfall«: System- und Legitimationskrisen in der neuzeitlichen Geschichte
Vor allem die Konsequenzen von Kriegen reichten in diesem Sinne weit über die unmittelbaren Folgen bloßer militärischer Auseinandersetzungen hinaus. Gerade bei längeren Kriegen, die mit enormen Kosten und Opfern einhergingen, widersprachen die Erfahrungen den rhetorischen Versprechen von »Siegen« und »Durchbrüchen«, mit denen Kriege häufig begonnen hatten. Zu den Kriegen der Neuzeit gehörte die Erfahrung, dass für viele Probleme, etwa die Versorgung der militärischen Front und der Heimatgesellschaften, die Finanzierung langwieriger Feldzüge oder die gerechte Verteilung von Opfern und Lasten keine Planungen oder gar Blaupausen vorlagen. Zum Ernstfall eines unabsehbar langen Krieges gehörte, dass viele Vorkriegsplanungen angesichts ungeplanter Dynamiken, kontingenter Prozesse und notwendiger Improvisation zur Makulatur wurden. Wo es nicht zu schnellen Entscheidungsschlachten kam, wurde der Modus des Aushaltens und Durchhaltens für viele Kriegsgesellschaften charakteristisch. Insofern erwiesen gerade Kriege immer wieder die Dysfunktionalität politischer oder wirtschaftlicher Strukturen und die Grenzen der Planbarkeit.
Große Krisenereignisse wie Kriege und Revolutionen markieren vor diesem Hintergrund den Testfall für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Steuerungsfähigkeit. Das galt für den Staat in der Französischen Revolution oder in der Phase der Weltwirtschaftskrise am Ende der 1920er Jahre genauso wie für die sozialen Sicherungssysteme während der Weltkriege oder am Ende der »Trente Glorieuses« bzw. »nach dem Boom« im Laufe der 1970er Jahre. Gemessen an der Wahrnehmung der Dramatik der Krise erschienen konkrete Handlungsoptionen häufig sehr begrenzt. Hier erwies sich ein wichtiges Grundmuster historischer Ernstfälle: Jede einmal ausgebrochene Krise – ein großer Krieg oder eine Revolution – unterschied sich vom zuvor prophezeiten, geplanten, prognostizierten Verlauf. Mit immer längerer Dauer von Kriegen oder Revolutionen nahm die nicht antizipierbare Dynamik und damit auch der Druck auf politische und soziale Systeme deutlich zu. Exemplarisch für diese Konstellation war der Verlauf des Ersten Weltkriegs. Seit dem Sommer 1914 entstand eine immer weiter auseinanderstrebende Kluft zwischen militärischen Detailplanungen und fehlender Vorbereitung auf einen unabsehbar langen Krieg. Die Folge waren enorme Probleme bei der Versorgung der Truppen mit Munition, eine schwere Rohstoffkrise des Deutschen Reiches, auf die erst Walther Rathenau mit einem System staatlicher Bewirtschaftung und der Produktion von Ersatzstoffen eine Antwort fand. Eine weitere Reaktion bestand darin, Strukturen eines »organisierten Kapitalismus« zu entwickeln, in dem der Kriegsstaat korporatistische Mechanismen der Interessenvermittlung zwischen Unternehmen und Gewerkschaften durchsetzte, um den Zusammenhalt der Heimatfront zu sichern.
Wie der Krieg als »großer Ernstfall« moderner Gesellschaften, als Testfall für staatliches Handeln wirkte, ließ sich an dem seit dem 16. Jahrhundert entstandenen engen Zusammenhang zwischen Kriegen, Staatsbildung und politischer Teilhabe nachvollziehen. Im fiscal-military state bildeten seit der Frühen Neuzeit Kriegsstaat und Steuerstaat zwei Seiten einer Medaille. Dazu kam die Verbindung zwischen Steuerstaatlichkeit und geregelter Partizipation, um ein Minimum an Vertrauen in staatliche Finanzpolitik sicherzustellen (»No taxation without representation«), indem man die Besteuerten institutionell an politischen Entscheidungen beteiligte. Wie stark Staatsverschuldung in Kriegsphasen zum Katalysator für Reformagenden werden konnte, bewiesen die ehemaligen napoleonischen Rheinbundstaaten am Beginn des 19. Jahrhunderts. Diese Wirkung des Krieges setzte sich auch im 20. Jahrhundert fort, als die Erfahrungen in den beiden Weltkriegen die Ausbildung wohlfahrtsstaatlicher Strukturen katalysierten – im Sozialstaat der Weimarer Republik genauso wie im staatlichen Gesundheitssystem Großbritanniens nach 1945.
In diesen Kontext der Wirkung von Kriegen als Ernstfall der Steuerungsfähigkeit politischer, wirtschaftlicher und sozialer Steuerung gehört auch der Zusammenhang zwischen Kriegsniederlagen und Reformimpulsen. Immer wieder wirkten Kriege als historische Effizienztests, nicht allein für militärische Leistungskraft, sondern für die Glaubwürdigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit politischer und sozialer Strukturen. Die Preußischen Reformen nach 1806 waren vor diesem Hintergrund ein von Reformbeamten und progressiven Militärs initiierter Versuch, um eine Antwort auf die katastrophale Niederlage Preußens gegen Napoleon zu finden. Die russische Niederlage im Krimkrieg 1856 verstärkte die Bemühungen um durchgreifende Reformen im Zarenreich, und erst die Niederlage gegen Japan 1905 transformierte die autokratische Monarchie des Zarenreichs zumindest auf formaler Ebene in eine konstitutionelle Monarchie mit einem Parlament. Dass 1917 eine solche Systemreform in Russland nach einer Reihe militärischer Niederlagen nicht mehr gelang, sollte erheblich zum Erfolg der Bolschewiki beitragen. Auch der 1867 gefundene »Ausgleich« in der Habsburgermonarchie folgte einer militärischen Niederlage. Die Lösung der deutschen Frage zugunsten Preußens durch den Ausgang der Schlacht von Königgrätz 1866 zwang die Wiener Regierung dazu, die eigene Monarchie in einen neuen konstitutionellen Rahmen zu stellen. Auch die innere Reformagenda der Dritten Französischen Republik war wesentlich dem Trauma der Niederlage von 1870/71 zu verdanken. Immer erschien die innere Regeneration wie auch die Bereitschaft, vom Gegner zu lernen, in diesen Fällen als entscheidende Voraussetzung für eine zukünftige äußere Behauptung. Anders im Falle der katastrophalen Niederlagen Deutschlands und Japans 1945, als der Kriegsausgang das Ende eines faschistischen bzw. militärautokratischen Regimetypus markierte. Langfristig entstand daraus ein Startvorteil in einem Prozess des politischen Neuanfangs und der sozialen und wirtschaftlichen Erholung. Für Westdeutschland lange Zeit gültige Belastungsfaktoren fielen nach 1945 fort, so insbesondere das Militär als »Staat im Staate«, aber auch die Rolle agrarischer Eliten in der Politik.
Kriege wirkten zugleich als Überprüfung der politischen, sozialen und ökonomischen Widerstandsfähigkeit – und damit für die Legitimation von Ordnungen. So dokumentierte der Erste Weltkrieg die langfristige Überlegenheit der stärker demokratischen Staaten gegenüber den autokratischen Militärmonarchien. Das zeigte sich vor allem in der Verteilung der Kriegslasten. Während einer schweren inneren Krise, die 1917 in Frankreich mit Massenmeutereien an der Front und Streiks in wichtigen Industriezentren einherging, gelang es der Führung, trotz der schweren Auseinandersetzungen, ein Minimum an Vertrauen in die politischen Entscheidungen und die Akteure aufrechtzuerhalten. Das galt auch für Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Trotz der enormen Belastungen bewahrten Politiker wie Woodrow Wilson, David Lloyd George und George Clemenceau ihre Glaubwürdigkeit und trugen zur Integration ihrer Kriegsgesellschaften bei, während die Monarchen und die meisten führenden Militärs in den Gesellschaften der Mittelmächte im Herbst 1918 kaum mehr Vertrauen genossen.
Der Ernstfall konnte nicht allein als Effizienztest und Reformimpuls wirken, sondern intensivierte im frühen 20. Jahrhundert ebenso Diskussionen um den Charakter der Souveränität. So argumentierte Carl Schmitt aus der Erfahrung der Krise seit dem Weltkrieg und blickte dabei vor allem auf den modernen Kriegsstaat mit seinen neuen Instrumenten, für die der »organisierte Kapitalismus« und das im Weltkrieg entstandene Konzept der »Volksgemeinschaft« als Gegenbegriff zur Konkurrenz sozialer Klassen standen. Schmitt wandte sich gegen das Paradigma der Volkssouveränität und der klassischen Naturrechte und konzentrierte sich auf den Notwehr- und Ausnahmezustand. »Souveränität« entstand nach seiner Deutung nicht im regelmäßigen Rhythmus parlamentarischer Legislaturen, sondern aus der Krisensituation und der Reaktion darauf. Daher war für Schmitt der »Souverän« derjenige, der über einen Ausnahmezustand entscheiden und damit den »Ernstfall« überhaupt erst definieren könne.
Schmitt leitete vom Verweis auf die drängende Krisenlösung ein dezidiert antidemokratisches Modell politischer Herrschaft ab. Nicht zufällig entwickelte sich in der Krise der Demokratien...